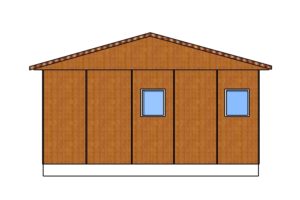Zweiter und letzter Teil des (leicht überarbeiteten) Manuskripts zum Vortrag* »Fußball und Fankultur in Israel«, gehalten am 9. Januar 2014 auf Einladung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft München im Jüdischen Museum München. (Zum ersten Teil geht es hier, angehört werden kann der Vortrag bei den Kollegen von 17grad.)
Nach der Aufnahme in die UEFA
Nach dieser Rückschau nun ein Sprung in die Gegenwart, die für Fußball-Israel gewissermaßen vor etwas mehr als 20 Jahren begonnen hat. Denn wie bereits ausgeführt, ging für den israelischen Fußballverband und die israelischen Spieler 1991 mit der Aufnahme in die UEFA eine Odyssee rund um den Globus zu Ende. Gleichzeitig bekam der israelische Fußball dadurch einen weiteren Schub. Zwar zahlten die Klubs in ihren internationalen Spielen vor allem zu Beginn das berühmte Lehrgeld, doch das neue fußballerische Zuhause und die damit zusammenhängenden Herausforderungen bewirkten entscheidende Änderungen: Die Zuschauerzahlen und die Spielergehälter stiegen, die Liga wurde aufgewertet, das Bezahlfernsehen stieg in den Fußball ein, Sponsoren und Mäzene pumpten Geld in die Klubs, israelische Spieler und israelische Klubs wurden auch außerhalb des Landes interessanter.
Nicht zuletzt diese Professionalisierung führte schließlich auch dazu, dass Israel im Sommer des vergangenen Jahres Gastgeber der U21-Europameisterschaft werden konnte. Es war das größte und wichtigste Fußballturnier, das jemals im jüdischen Staat ausgetragen wurde, und es war der wohl größte sportpolitische Erfolg der israelischen Fußballgeschichte. Die Begeisterung im Land war groß, die – eigens für das Turnier ausgebauten – Stadien waren bestens gefüllt, und mit der Sicherheit gab es entgegen manch anders lautender Befürchtung ebenfalls keine Probleme.
Doch zugleich machten verschiedene Geschehnisse im Vorfeld des Turniers deutlich, dass Israel von zu vielen noch immer nicht als gleich- und vollwertiges Mitglied in Fußball-Europa betrachtet wird. Denn es gab allerlei politischen Protest: Im November 2012 beispielsweise traten mehr als 50 Fußballprofis – darunter die früheren Bundesligaspieler Papiss Demba Cissé und Demba Ba – mit einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit, in der sie gegen die israelischen Militärschläge im Gaza-Streifen protestierten, ihre »Solidarität mit der belagerten Bevölkerung in Gaza« ausdrückten und sich dagegen aussprachen, die Europameisterschaft in Israel stattfinden zu lassen. Im Frühjahr 2013 störten einige Demonstranten eine Abendveranstaltung des europäischen Verbands im Rahmen eines UEFA-Kongresses in London, indem sie dort antiisraelische Parolen riefen und eine palästinensische Fahne schwenkten.
Und noch wenige Tage vor dem Beginn des Turniers unternahmen einige besonders notorische Gegner Israels einen letzten Versuch, die UEFA zur Absage des Turniers im jüdischen Staat zu bewegen. Der europäische Verband belohne »Israels grausames und gesetzloses Verhalten«, hieß es in einem offenen Brief, den unter anderem der ehemalige südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu, der französisch-malische Ex-Fußballprofi Frédéric Kanouté und der britische Filmregisseur Ken Loach unterschrieben hatten. Die UEFA, so meinten die Initiatoren weiter, solle es Israel nicht gestatten, »ein prestigeträchtiges Fußballereignis dazu zu benutzen, um seine rassistisch motivierte Verweigerung von Rechten für die Palästinenser und die illegale Besatzung von palästinensischem Land zu übertünchen«. Auch wenn es schon sehr spät sei, fordere man die UEFA dazu auf, »die Entscheidung, Israel dieses Turnier austragen zu lassen, zu widerrufen«. Glücklicherweise ohne Erfolg.
Dabei gab es auch zwischen dem israelischen und dem europäischen Fußballverband in den Jahren zuvor immer mal wieder Spannungen. Als beispielsweise die Zweite Intifada ab dem Jahr 2000 ihren Terror ausagierte, mussten israelische Teams auf Geheiß der UEFA ihre Heimspiele in den internationalen Wettbewerben auf Zypern austragen, weil es den anreisenden Klubs angeblich nicht zuzumuten war, in Israel zu kicken. Erst nach dem Bau des Sicherheitszauns und dem Rückgang der Selbstmordattentate genehmigte die UEFA im April 2004 wieder die Austragung von Partien im Land.
Auch während des Libanonkrieges im Sommer 2006 und noch längere Zeit danach wurden israelische Klubs und die israelische Nationalmannschaft für den Terror bestraft, der den jüdischen Staat heimsuchte. Monatelang mussten sie ihre Heimspiele in den internationalen Wettbewerben jenseits der Landesgrenzen austragen, teilweise auch noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Zur Begründung hieß es, die Sicherheit der Sportler in Israel sei nicht ausreichend gewährleistet. Der Ärger, den diese Entscheidung in Israel seinerzeit auslöste, lässt sich nachvollziehen. Denn würde die UEFA in allen Fällen mit gleichem Maß messen, hätte sie zumindest auch die Heimspiele spanischer und englischer Teams nach den Terrorangriffen von Madrid und London oder die Partien türkischer Mannschaften nach dem Anschlag in Antalya im August 2006 verlegen müssen. Doch nichts dergleichen geschah.
Hinzu kommt, dass israelische Mannschaften und israelische Spieler immer wieder mit verschiedenen Formen des Antisemitismus konfrontiert sind. Ein Beispiel sind entsprechende Transparente und Parolen in den Stadien, wie etwa beim Länderspiel zwischen Ungarn und Israel im August 2012 oder beim UEFA-Pokal-Spiel zwischen Paris St. Germain und Hapoel Tel Aviv im November 2006 (nach dieser Partie kam es sogar noch zu einer regelrechten Hetzjagd französischer Neonazis auf Hapoel-Anhänger). In diesem Zusammenhang wären auch die antisemitischen Beschimpfungen zu nennen, die der israelische Nationalspieler Itay Shechter im Februar 2012 bei einer Trainingseinheit des 1. FC Kaiserslautern erdulden musste.
Ein anderes Beispiel sind Spieler aus islamischen Staaten oder mit muslimischem Hintergrund, die nicht gegen israelische Teams spielen wollen. Hier wären etwa die früheren Bundesligaprofis Vahid Hashemian und Ashkan Dejagah zu nennen: Der damalige iranische Nationalspieler Hashemian fehlte im Herbst 2004 in beiden Champions-League-Partien des FC Bayern gegen Maccabi Tel Aviv – offiziell wegen einer Verletzung, aber diese Begründung glaubte wirklich niemand. Und der Deutsch-Iraner Dejagah weigerte sich im Oktober 2007, mit der deutschen U21-Nationalmannschaft zum Europameisterschafts-Qualifikationsspiel nach Israel zu reisen. Die Spekulationen über seine Motive heizte Dejagah dabei selbst an. »Das hat politische Gründe«, wurde er seinerzeit in verschiedenen Zeitungen zitiert. Weiter sagte er: »Ich habe mehr iranisches als deutsches Blut in meinen Adern. Außerdem tue ich es aus Respekt, schließlich sind meine Eltern Iraner.«
Und dann gibt es da noch Klubs, die Trainingslager in Staaten veranstalten, die Israel nicht anerkennen. Wie etwa – um ein ganz aktuelles Beispiel zu nennen – der niederländische Erstligist Vitesse Arnheim, der seinen israelischen Verteidiger Dan Mori einfach zu Hause ließ, nachdem die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate angekündigt hatten, ihm die Einreise zu verweigern, weil er Israeli ist.
 Doch all diesen Dingen zum Trotz hat der israelische Fußball einen erkennbaren Sprung nach vorne gemacht. Israelische Profis werden in den europäischen Ligen mittlerweile durchaus geschätzt. Nicht nur in England – wo sich nach Ronny Rosenthal (Foto, rechts), der bereits in den 1990er Jahren erfolgreich für Liverpool, die Spurs und Watford spielte, vor allem Yossi Benayoun (Foto, links) einen Namen machte –, sondern auch in der Bundesliga, wie etwa Beispiele aus den vergangenen Jahren wie Itay Shechter, Almog Cohen, Gal Alberman oder Roberto Colautti zeigen. Die israelische Ligat ha’Al wiederum zählt zwar fraglos weiterhin nicht zu den ersten Adressen im europäischen Fußball, doch auch hier treten neben den einheimischen auch immer mehr internationale Spieler gegen den Ball. Und israelische Klubs qualifizieren sich inzwischen auch schon mal für die Gruppenphase der Champions League und bleiben in der Europa League nicht mehr zwangsläufig in der Qualifikation oder der Vorrunde hängen, wie es früher regelmäßig der Fall war.
Doch all diesen Dingen zum Trotz hat der israelische Fußball einen erkennbaren Sprung nach vorne gemacht. Israelische Profis werden in den europäischen Ligen mittlerweile durchaus geschätzt. Nicht nur in England – wo sich nach Ronny Rosenthal (Foto, rechts), der bereits in den 1990er Jahren erfolgreich für Liverpool, die Spurs und Watford spielte, vor allem Yossi Benayoun (Foto, links) einen Namen machte –, sondern auch in der Bundesliga, wie etwa Beispiele aus den vergangenen Jahren wie Itay Shechter, Almog Cohen, Gal Alberman oder Roberto Colautti zeigen. Die israelische Ligat ha’Al wiederum zählt zwar fraglos weiterhin nicht zu den ersten Adressen im europäischen Fußball, doch auch hier treten neben den einheimischen auch immer mehr internationale Spieler gegen den Ball. Und israelische Klubs qualifizieren sich inzwischen auch schon mal für die Gruppenphase der Champions League und bleiben in der Europa League nicht mehr zwangsläufig in der Qualifikation oder der Vorrunde hängen, wie es früher regelmäßig der Fall war.
Bei der Nivchéret, der Nationalmannschaft, darf man ebenfalls davon ausgehen, dass der Tag nicht mehr fern ist, an dem die zweite WM-Teilnahme (oder die erste an einer Europameisterschaft) gefeiert werden kann und Günter Netzers Urteil vom Juni 2001 – »Die Israelis spielen einen hervorragenden Fußball, den sie nicht in Ergebnisse umwandeln können« – widerlegt wird. Die Konkurrenzfähigkeit ist jedenfalls größer geworden, und ein paar Mal war es ja auch schon recht knapp. Außerdem steht wohl nicht mehr zu befürchten, dass sich die Nationalspieler derart unprofessionell verhalten wie 1999, als sich mehrere Akteure am Abend vor dem alles entscheidenden EM-Qualifikationsspiel gegen Dänemark mit Prostituierten vergnügten – und das Match dann mit 0:5 vergeigten.**
Fußballfans in Israel
Das sorgte seinerzeit für eine Menge Unmut auch unter den israelischen Fußballfans, um die es nun gehen soll. Wie generell im Fußball hat sich auch im israelischen vor allem in den vergangenen 20 Jahren sehr viel verändert. Was jedoch erhalten geblieben ist, ist die – nicht nur sportlich, sondern eben auch politisch bedingte – Rivalität zwischen den Klubs, wobei diese sich im Laufe der Jahre mehr und mehr vom Platz und den Klubzentralen auf die Ränge verlagert hat. Einem Spieler wird es im Zweifelsfall gleichgültig sein, ob er bei Maccabi, Hapoel oder Beitar sein Geld verdient; für die Anhänger spielt das jedoch weiterhin eine große Rolle. Dazu muss gesagt werden, dass sich eine organisierte Fan- und Ultrà-Szene in Israel erst relativ spät entwickelt hat, nämlich Ende der 1990er Jahre. Zunächst gab es überhaupt nur zwei organisierte Fangruppen – die von Hapoel Tel Aviv und die von Maccabi Tel Aviv. Seit 2007 existiert die Vereinigung Israfans, eine Dachorganisation von Fußballfans, in der rund 25 Ultrà-Gruppierungen, Fanprojekte und Fanklubs zusammengeschlossen sind.
Zu den Anliegen von Israfans gehört vieles, was man auch von Fanvereinigungen hierzulande kennt, beispielsweise der Kampf gegen zu harte Polizeieinsätze, gegen eine zunehmende Entfremdung zwischen Klubführungen und Fans und gegen zu hohe Ticketpreise; der Einsatz für eine Vernetzung der Fangruppen, für Fanrechte und für eine bessere Zusammenarbeit mit den Klubs. Es gibt einen organisierten Austausch mit Fußballfans aus Europa; die finanziellen und personellen Ressourcen sind jedoch begrenzt, und der Einfluss von Israfans könnte zweifellos größer sein. Angesichts des Desinteresses vieler Klubführungen an einer Zusammenarbeit mit dieser Vereinigung und eingedenk manch harter Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppierungen ist die Arbeit für die Aktivisten von Israfans allerdings auch alles andere als leicht.
 Die größten Differenzen im Lager der Fans gibt es zweifellos zwischen den Ultràs von Hapoel Tel Aviv und den Anhängern von Maccabi Tel Aviv sowie insbesondere von Beitar Jerusalem; hier ist die historische Gegnerschaft in vielerlei Hinsicht erhalten geblieben. Die Hapoel-Ultràs – die in fanpolitischen Belangen zu den aktivsten in Israel gehören und beispielsweise zu Ultràs des FC St. Pauli gute Kontakte pflegen – verstehen sich dezidiert als links und antizionistisch; sie lehnen beispielsweise das Zeigen von israelischen Fahnen im Stadion ab, halten die Politik der Regierung gegenüber den Palästinensern für »rassistisch« und stehen auch der Polizei ablehnend bis feindlich gegenüber. Der arabische Antisemitismus und die damit verbundene Bedrohung Israels sind bei dieser Gruppierung kein Thema, vielmehr skandieren ihre Mitglieder bei Spielen auch schon mal Parolen wie »Gebt Jerusalem den Palästinensern« oder »Jerusalem gehört zu Jordanien«.
Die größten Differenzen im Lager der Fans gibt es zweifellos zwischen den Ultràs von Hapoel Tel Aviv und den Anhängern von Maccabi Tel Aviv sowie insbesondere von Beitar Jerusalem; hier ist die historische Gegnerschaft in vielerlei Hinsicht erhalten geblieben. Die Hapoel-Ultràs – die in fanpolitischen Belangen zu den aktivsten in Israel gehören und beispielsweise zu Ultràs des FC St. Pauli gute Kontakte pflegen – verstehen sich dezidiert als links und antizionistisch; sie lehnen beispielsweise das Zeigen von israelischen Fahnen im Stadion ab, halten die Politik der Regierung gegenüber den Palästinensern für »rassistisch« und stehen auch der Polizei ablehnend bis feindlich gegenüber. Der arabische Antisemitismus und die damit verbundene Bedrohung Israels sind bei dieser Gruppierung kein Thema, vielmehr skandieren ihre Mitglieder bei Spielen auch schon mal Parolen wie »Gebt Jerusalem den Palästinensern« oder »Jerusalem gehört zu Jordanien«.
Bei Beitar wiederum fallen immer wieder Fans, insbesondere die der Gruppe La Familia, durch antiarabische Aktivitäten auf. Im März 2012 etwa griffen Beitar-Anhänger nach einem Spiel arabische Israelis in einem Supermarkt an, im Februar 2013 wurde im Clubhaus von Beitar sogar Feuer gelegt, nachdem der Verein angekündigt hatte, zwei muslimische Spieler unter Vertrag zu nehmen. Schon in der Vergangenheit hatte die Klubführung nach massiven Protesten von der Verpflichtung arabischer Spieler abgesehen. Feindselige Rufe gegen Araber im Stadion sind bei Beitar ohnehin eher die Regel als die Ausnahme.
Mehrfach hat der israelische Fußballverband den Klub nach Krawallen bestraft: mit Geldbußen, mit der vorübergehenden Schließung der Kurve, mit Spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, mit Punktabzügen. Auch in der israelischen Öffentlichkeit und Politik wurden die jüngsten Ausschreitungen scharf verurteilt: Die Zeitungen des Landes gingen mit Beitar ins Gericht, Premierminister Benjamin Netanjahu – selbst langjähriges Klubmitglied – sprach von einer »Schande«, auch der Jerusalemer Bürgermeister Nir Barkat war entsetzt, und der frühere Premierminister Ehud Olmert, ebenfalls seit langem ein Anhänger von Beitar Jerusalem, schrieb in einem Gastbeitrag in der Tageszeitung Yedioth Ahronoth, er werde so lange keine Spiele seines Lieblingsvereins mehr im Stadion anschauen, »bis die Rassisten von den Rängen und aus dem Klub entfernt worden sind«. Die beiden muslimischen Spieler wurden schließlich verpflichtet, und als einer von ihnen, der Tschetschene Gabriel Kadiev, bei seinem ersten Einsatz im Spiel gegen den arabischen Klub Bnei Sachnin eingewechselt wurde, übertönte der Applaus auf den Rängen die Pfiffe und Schmährufe deutlich.
Wenn man von Beitar Jerusalem absieht, sind arabische Spieler im israelischen Fußball ohnehin längst gang und gäbe; ihr prozentualer Anteil entspricht etwa dem der arabischen Israelis an der Gesamtbevölkerung des Landes. Der erste Araber in der Nivchéret – und der erste Araber überhaupt, der Israel bei Olympischen Spielen repräsentierte – war 1976 Rifaat Turk von Hapoel Tel Aviv. Der erste arabisch-israelische Klub, der es in die höchste israelische Spielklasse schaffte, war 1996 Hapoel Taibe, und mit dem FC Bnei Sachnin gewann 2004 ein anderer arabisch-israelischer Klub sogar den israelischen Pokal.
Doch zurück zu den Fans. Die meisten haben die vier »Großen« des israelischen Fußballs: Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Haifa und Beitar Jerusalem. Die Hapoel-Ultràs werden von den Fans anderer Klubs – nicht nur von den Beitar-Anhängern – wegen ihrer politischen Positionen schon mal als »Hisbollah« beschimpft. Aber solche polemischen Bezeichnungen sind im hochpolitischen Israel ein fester Bestandteil der Streitkultur und nichts wirklich Ungewöhnliches. Bei den arabischen Israelis liegt Hapoel gemeinsam mit Maccabi Haifa in der Gunst ganz vorne, bei den linken ohnehin. Wer eine der Parteien der Mitte wählt, wird womöglich mit Maccabi Tel Aviv sympathisieren, wer dem Likud nahe steht, hält es vielleicht mit Beitar. Die Rivalität ist nicht unerheblich, doch insgesamt – so sagt es selbst der sonst »israelkritische« Moshe Zimmermann – seien »die Rangeleien, zu denen es manchmal kommt, ungefähr von der Qualität, wie sie auch beim Lokalderby des 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen vorkommen«.
 Das vielleicht bemerkenswerteste Projekt israelischer Fußballfans ist jedoch Hapoel Katamon Jerusalem – ein Klub, der von Fans gegründet wurde, von ihnen geführt wird und mittlerweile in der Liga Le’umit spielt, der zweithöchsten Klasse Israels. Er ist das Kind enttäuschter Anhänger von Hapoel Jerusalem, die vergeblich versucht hatten, ihren sportlich weitgehend bedeutungslos gewordenen und hochverschuldeten Lieblingsverein, der 1973 den israelischen Pokal gewonnen hatte und lange Zeit auf Augenhöhe mit dem Stadtrivalen Beitar war, zu kaufen. Im Jahr 2007 bauten sie »Katamon« bei einem bereits existierenden Viertligisten auf, unternahmen zwei Jahre später einen – ebenfalls erfolglosen – Versuch einer Fusion mit Hapoel Jerusalem und gründeten schließlich Hapoel Katamon Jerusalem als eigenständigen Verein, der fortan gewissermaßen das »wahre« Hapoel Jerusalem verkörpern sollte. Der Klub begann in der untersten, fünften Spielklasse, stieg 2010, 2011 und 2013 jeweils auf und spielt nun, genau wie Hapoel Jerusalem, in der zweiten Liga. Er hat allerdings deutlich mehr Zuschauer – und sozial engagierte Fans, die beispielsweise äthiopischen Immigranten Hebräisch beibringen und Schulkinder betreuen.
Das vielleicht bemerkenswerteste Projekt israelischer Fußballfans ist jedoch Hapoel Katamon Jerusalem – ein Klub, der von Fans gegründet wurde, von ihnen geführt wird und mittlerweile in der Liga Le’umit spielt, der zweithöchsten Klasse Israels. Er ist das Kind enttäuschter Anhänger von Hapoel Jerusalem, die vergeblich versucht hatten, ihren sportlich weitgehend bedeutungslos gewordenen und hochverschuldeten Lieblingsverein, der 1973 den israelischen Pokal gewonnen hatte und lange Zeit auf Augenhöhe mit dem Stadtrivalen Beitar war, zu kaufen. Im Jahr 2007 bauten sie »Katamon« bei einem bereits existierenden Viertligisten auf, unternahmen zwei Jahre später einen – ebenfalls erfolglosen – Versuch einer Fusion mit Hapoel Jerusalem und gründeten schließlich Hapoel Katamon Jerusalem als eigenständigen Verein, der fortan gewissermaßen das »wahre« Hapoel Jerusalem verkörpern sollte. Der Klub begann in der untersten, fünften Spielklasse, stieg 2010, 2011 und 2013 jeweils auf und spielt nun, genau wie Hapoel Jerusalem, in der zweiten Liga. Er hat allerdings deutlich mehr Zuschauer – und sozial engagierte Fans, die beispielsweise äthiopischen Immigranten Hebräisch beibringen und Schulkinder betreuen.
 Zur israelisch-deutschen Fußballgeschichte
Zur israelisch-deutschen Fußballgeschichte
Abschließend noch einige Betrachtungen zur israelisch-deutschen Fußballgeschichte, die nicht fehlen sollte, wenn es hierzulande um die Historie des Fußballs im jüdischen Staat geht. 1969 kam es erstmals zu zwei Spielen zwischen israelischen Mannschaften und einem deutschen Team, nämlich dem FC Bayern Hof. Die erste Partie bestritten die Hofer in Nahariya gegen eine Regionalauswahl (Foto), Schiedsrichter war der bereits erwähnte Avraham Klein. Im Interview der Jüdischen Allgemeinen erinnerte er sich an das Match: »Israels Fußballverband hatte mich gefragt, ob ich Probleme damit hätte, dieses Spiel zu pfeifen. Nach kurzer Bedenkzeit sagte ich: ›Nein, überhaupt nicht.‹ […] Es gab wütende Proteste, und ich wurde für meine Entscheidung offen angefeindet. Ein Mann, der als Kind den gelben Stern tragen musste und einen Großteil seiner Familie in der Schoa verloren hat, darf doch nicht einem deutschen Fußballer vor dem Anpfiff die Hand schütteln, hieß es. […] Ich habe es trotzdem gemacht und erst viel später gemerkt: Das Spiel war der größte Tag in meinem Schiedsrichterleben.« Bereits 1970 kam es zum Gegenbesuch einer israelischen Mannschaft in Hof, und ab 1970 reiste Borussia Mönchengladbach regelmäßig ins Trainingslager nach Israel, 14-mal insgesamt. Auch der erste – und lange Zeit einzige – israelische Bundesligaspieler, Schmuel Rosenthal, spielte für die Elf vom Niederrhein.
Deutlich jünger (und außerdem recht überschaubar) ist die israelisch-deutsche Länderspielgeschichte. Begonnen hat sie erst vor 27 Jahren, genauer gesagt: am 25. März 1987. Mit 2:0 gewannen die von Franz Beckenbauer trainierten Deutschen an jenem Tag das Spiel im nicht einmal halbvollen Stadion von Ramat Gan bei Tel Aviv, doch die sportlichen Belange interessierten seinerzeit weit weniger als die politischen Implikationen dieses sogenannten Freundschaftsspiels. Denn in Israel war begreiflicherweise längst nicht jeder einverstanden mit dieser Partie, und so blieb der seinerzeitige Staatspräsident Chaim Herzog ihr letztlich auch fern. Der Vizepräsident des israelischen Fußballverbands wiederum, Arieh Krämer, war zwar im Stadion, verließ es aber aus Protest gegen das Abspielen der deutschen Hymne wieder, das er im Vorfeld der Partie zu verhindern versucht hatte.
Der Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem durch die DFB-Delegation blieb unterdessen nicht frei von Peinlichkeiten. Nationalspieler Hans Pflügler etwa musste darüber aufgeklärt werden, dass er sich nicht in einer Gedenkstätte für gefallene israelische Soldaten befindet; Teamchef Franz Beckenbauer resümierte derweil: »Der Besuch brachte mir nichts Neues.« Und der damalige Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Hermann Neuberger – der im Zweiten Weltkrieg Hauptmann im Generalstab der Wehrmacht war – erzählte einem Vertreter der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, er sei »Soldat im Fronteinsatz« gewesen und habe »erst nach 1944 von den Konzentrationslagern erfahren«.
Neuberger war es auch, der 1978 während der Weltmeisterschaft im faschistischen Argentinien Hans-Ulrich Rudel ins deutsche WM-Quartier eingeladen hatte – einen früheren Wehrmachtsoffizier, Träger des »Ritterkreuzes« und Hitlers Lieblingssturzkampfflieger, der sich nach Kriegsende als Waffenhändler und Fluchthelfer für Nazis betätigt hatte und die rechtsextreme »Deutsche Reichspartei« unterstützte. Kritik an der Einladung Rudels quittierte Neuberger mit den lapidaren Worten: »Ich hoffe doch nicht, dass man ihm seine Kampffliegertätigkeit während des Zweiten Weltkriegs vorwerfen will.« Bevor er DFB-Präsident wurde, hatte Neuberger unter anderem als Sportredakteur bei der Saarbrücker Zeitung gearbeitet, war dort jedoch bald wegen revanchistischer Kommentare entlassen worden. Solche Konsequenzen musste er als höchster Funktionär des Deutschen Fußball-Bundes, der sich bekanntlich erst lange nach Neubergers Zeit mit seiner Geschichte vor 1945 auseinanderzusetzen begann, nicht befürchten. Dass Neubergers Frau – wie der heutige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach unlängst in einem Interview »tief beeindruckt« berichtete – »in den Bergen Judäas Bäume pflanzte«, darf in diesem Kontext als durchsichtige, medienwirksame Goodwill-Aktion betrachtet werden, die nichts als ein wenig Gratismut erforderte.
Auf den autoritären Neuberger folgte nach dessen Tod 1992 der etwas onkelhafte Rheinländer Egidius Braun, in dessen Amtszeit auch das zweite Länderspiel zwischen Israel und Deutschland fiel, das am 26. Februar 1997 stattfand und mit einem 1:0 für die DFB-Kicker endete. Erneut war das Stadion in Ramat Gan nur zur Hälfte gefüllt; die Behauptung deutscher Medien, in Israel fiebere man dem Spiel gegen die Deutschen schon lange entgegen, war nichts als Wunschdenken. Und auch der politische Auftritt der DFB-Delegation ging erneut daneben. Präsident Braun glaubte schon vorher, seine Gastgeber belehren zu müssen, als er sagte: »Die Israelis und wir sollten nicht vergessen.« Und er konkretisierte seine Mahnung mit den Worten: »Wir sollten ein Bündnis mit den Lebenden und den Toten schließen. Erinnerung ist ein Weg zur Erlösung.« Für die Nationalspieler war vor der Reise nach Israel eigens ein Vorbereitungsseminar anberaumt worden, doch allzu viel schien so mancher dabei nicht mitgenommen zu haben.
»Das kann doch nicht wahr sein! Hat’s so etwas wirklich gegeben, Trainer?«, sagte etwa Nationalspieler Mario Basler zu seinem Coach Berti Vogts in Yad Vashem, vor einem Foto stehend, auf dem ein KZ-Wärter einen verzweifelten Juden exekutieren will. Vogts antwortete ihm mit den Worten: »Doch, so war es.« Daraufhin Basler noch einmal: »Das kann doch nicht wahr sein!«*** Und Egidius Braun fragte die zahlreichen mitgereisten deutschen Journalisten vor Fotoaufnahmen, ob er »noch betroffener gucken« solle. Der ganze Sinn und Zweck dieser Übung wurde später im hauseigenen DFB-Journal resümiert; dort hieß es: »Anerkennung erntete die DFB-Equipe für ihr besonnenes Auftreten beim Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, das ein weitweit positives Echo auslöste.« Imagepflege durch »Vergangenheitsbewältigung« also – vor allem darum ging es.
Zum dritten Spiel zwischen den Auswahlmannschaften des DFB und der Israel Football Association kam es am 13. Februar 2002. Dieses Match fand nur deshalb in Deutschland (genauer gesagt, in Kaiserslautern) statt, weil die Verantwortlichen des Deutschen Fußball-Bundes der Ansicht waren, ihren Spielern die Reise nach Israel aus Sicherheitsgründen diesmal nicht zumuten zu können. Aus Furcht vor antisemitischen Ausschreitungen war der Kartenverkauf massiv kontrolliert und das Polizeiaufgebot am und im Stadion deutlich verstärkt worden. Die Deutschen gewannen die Partie mit 7:1; zur Pause hatten die Israelis nach einem Eigentor von Oliver Kahn noch mit 1:0 geführt. Die vierte und bislang letzte Partie gewann das DFB-Team am 31. Mai 2012 in Leipzig mit 2:0. Wer das Spiel vor Ort im israelischen Block verfolgt hat, wird nicht vergessen, wie irritiert viele israelische Fans reagiert haben, als durch das Stadion das offenbar unvermeidliche »Sieg«-Stakkato hallte.
Jahrelang war der Deutsche Fußball-Bund also mit allerlei Unsäglichkeiten in Israel aufgefallen; das besserte sich erst in der Amtszeit seines Präsidenten Theo Zwanziger spürbar. Zwanziger verhielt sich erheblich diskreter als seine Vorgänger und machte weit weniger Aufhebens um Reisen und Kooperationen. Zu seinen Ideen zählte auch ein Austausch von Schiedsrichtern, doch bislang kam es erst zu einem Einsatz, nämlich dem des Berliner Referees Manuel Gräfe im März 2010 bei der Erstligapartie zwischen Maccabi Haifa und Maccabi Tel Aviv. Es war das erste Mal in der Geschichte des israelischen Fußballs, dass ein deutscher Schiedsrichter ein Match in der höchsten israelischen Spielklasse pfiff. Zur Leitung eines Spiels in Deutschland durch einen israelischen Schiedsrichter kam es bisher nicht, was auch damit zusammenhängen mag, dass Zwanzigers Nachfolger Wolfgang Niersbach sich weit weniger engagiert um das Verhältnis zum israelischen Fußballverband bemüht.
 Und dann ist da noch Lothar Matthäus. Als er 2008 als Trainer zum israelischen Erstligisten Maccabi Netanya ging, unkte nicht nur Uli Hoeneß, dass die deutsche Diplomatie künftig zum Eingreifen gezwungen sein könnte. Doch der deutsche Rekordnationalspieler, dem sein Mundwerk so oft zum Verhängnis wurde, verhielt sich vor und während seiner Tätigkeit in Israel völlig korrekt. In Interviews bekannte er, Israel zu mögen und gerne dort zu leben und zu arbeiten. Dass sein Engagement bei Maccabi nur ein Jahr dauerte, lag vornehmlich daran, dass dem Klub das Geld ausgegangen war und er Matthäus’ Gehalt deshalb nicht länger bezahlen konnte. Als Matthäus ging, hatte Netanya die Saison als Viertplatzierter abgeschlossen – ein gutes Resultat. Und anders als so mancher seiner Landsleute hat er in der israelisch-deutschen Fußballgeschichte eine durchaus positive Rolle gespielt.
Und dann ist da noch Lothar Matthäus. Als er 2008 als Trainer zum israelischen Erstligisten Maccabi Netanya ging, unkte nicht nur Uli Hoeneß, dass die deutsche Diplomatie künftig zum Eingreifen gezwungen sein könnte. Doch der deutsche Rekordnationalspieler, dem sein Mundwerk so oft zum Verhängnis wurde, verhielt sich vor und während seiner Tätigkeit in Israel völlig korrekt. In Interviews bekannte er, Israel zu mögen und gerne dort zu leben und zu arbeiten. Dass sein Engagement bei Maccabi nur ein Jahr dauerte, lag vornehmlich daran, dass dem Klub das Geld ausgegangen war und er Matthäus’ Gehalt deshalb nicht länger bezahlen konnte. Als Matthäus ging, hatte Netanya die Saison als Viertplatzierter abgeschlossen – ein gutes Resultat. Und anders als so mancher seiner Landsleute hat er in der israelisch-deutschen Fußballgeschichte eine durchaus positive Rolle gespielt.
Link-Tipp: Aktuelle Berichte und Beiträge zum israelischen Fußball gibt es auf dem Weblog »Fußball in Israel«, das auch über einen Twitter-Account verfügt.
* Für Vorträge an anderen Orten steht der Autor gerne zur Verfügung. Anfragen bitte per E-Mail oder über das Kontaktformular. Einzelne Teile des Vortrags – etwa der über die Fans in Israel –, die in dieser Überblicksdarstellung nur in geraffter Form präsentiert werden konnten, können dabei auf Wunsch gerne ausführlicher behandelt werden.
** Vgl. Stefan Mayr: Zwischen Intifada und Champions League. Fußball in Israel, in: Dietrich Schulze-Marmeling (Hg.): Davidstern und Lederball. Die Geschichte der Juden im deutschen und internationalen Fußball, Göttingen 2003 (Verlag Die Werkstatt), S. 488–505. Viele Angaben und Ausführungen, die hier nicht explizit anderweitig nachgewiesen sind, basieren auf diesem Beitrag.
*** Vgl. Martin Endemann: Sie bauen U-Bahnen nach Auschwitz. Antisemitismus im deutschen Fußball, in: Gerd Dembowski, Jürgen Scheidle (Hg.): Tatort Stadion. Rassismus, Antisemitismus und Sexismus im Fußball, Köln 2002 (PapyRossa Verlag), S. 80–89. Die Angaben und Ausführungen in diesem und im nächsten Absatz basieren auf diesem Text.
Einsortiert unter:Fußball, Politik Tagged: Avraham Klein, Beitar Jerusalem, FC Bnei Sachnin, Hapoel Katamon Jerusalem, Hapoel Taibe, Hapoel Tel Aviv, Israel, Lothar Matthäus, Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv, Manuel Gräfe, Rifaat Turk, Ronny Rosenthal, Schmuel Rosenthal, Ultras Hapoel, Ultras Maccabi, Yossi Benayoun